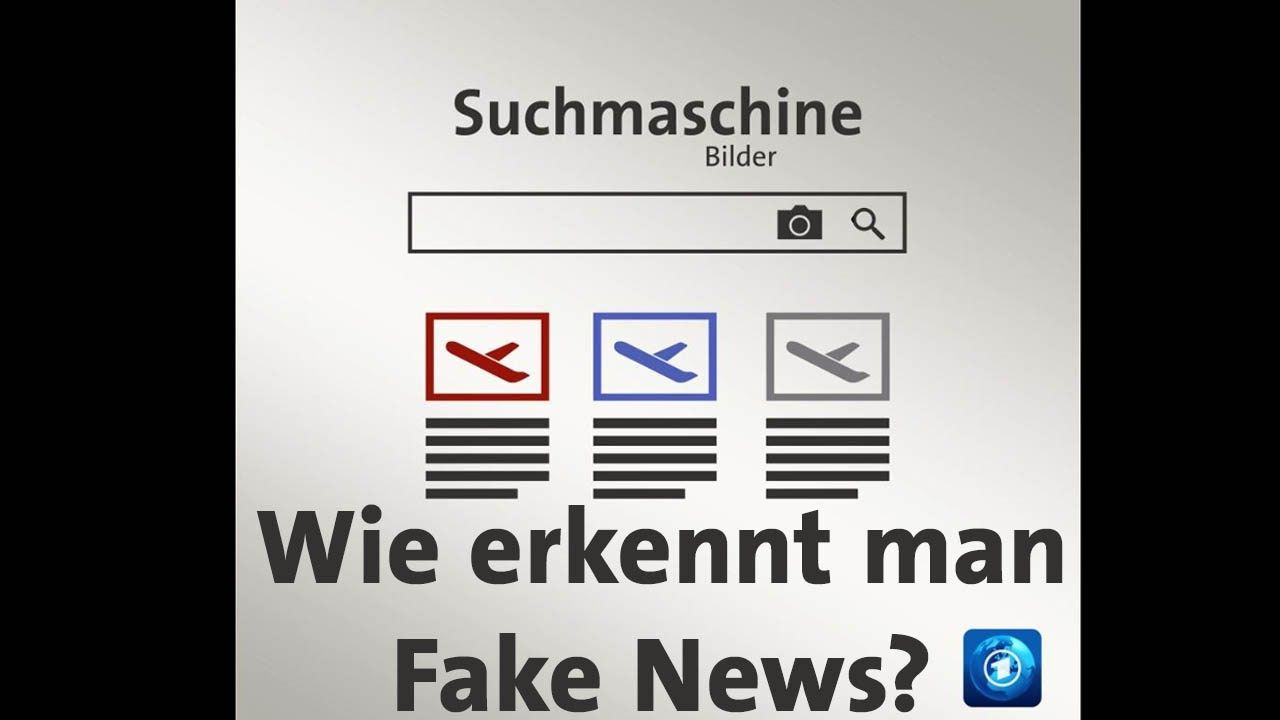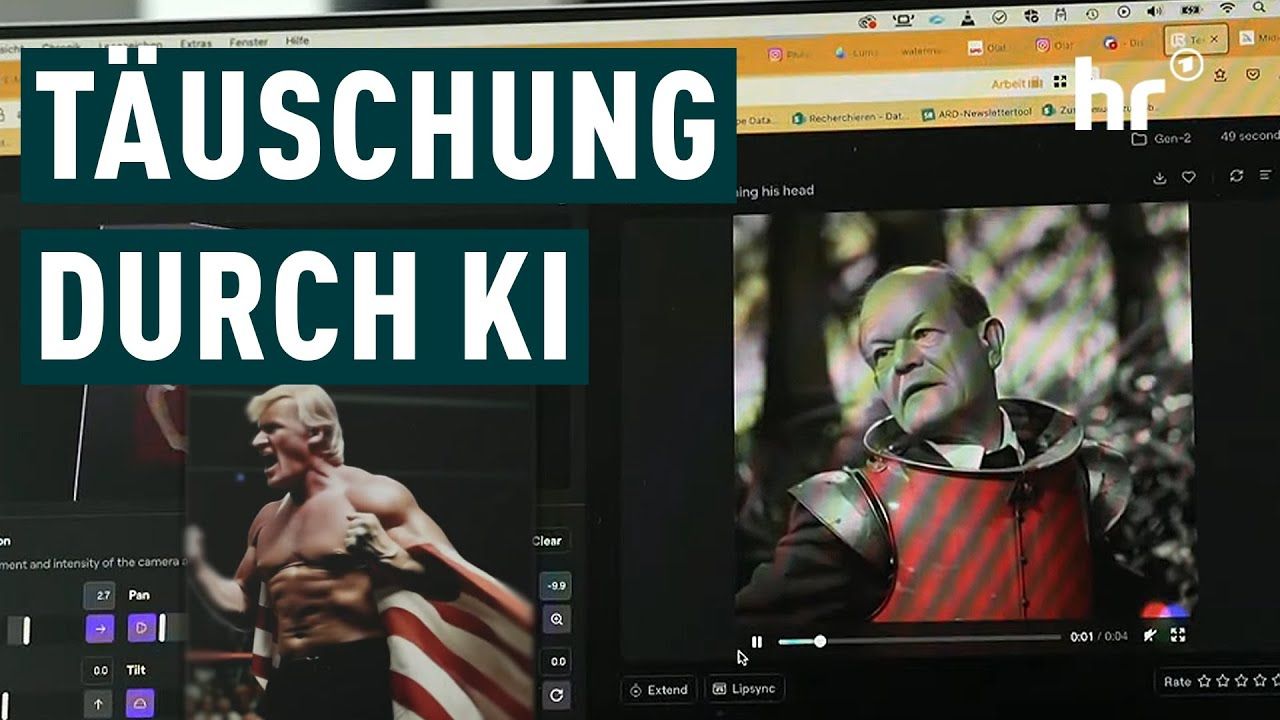Fake News erkennen und widerlegen
Fake News und Verschwörungstheorien sind nicht erst seit Covid-19 ein Problem. Vor allem in den Sozialen Medien wird gefährlicher Unsinn verbreitet. Manche Inhalte sind plump gefälscht, andere erst bei näherem Hinsehen als Falschmeldung erkennbar. Worauf du achten solltest und wie du Fake News enttarnst, verraten Expertinnen und Experten.
Darum geht's
- Krisenzeiten begünstigen Verschwörungstheorien
- Die vermeintlich Kritischen stellen sich gegen die „finstere“ globale Elite
- So erkennst du Falschmeldungen
- Corona-Pandemie: Weniger Falschmeldungen, mehr Verschwörungstheorien
- Ältere Jugendliche sind sensibilisiert für Fake News
- Die wachsende Rolle von KI
- Ein selbstkritischer Umgang mit Medien ist wichtig
Krisenzeiten begünstigen Verschwörungstheorien
Doch warum war gerade das Thema Corona so anfällig für Fake News? Zunächst einmal: Auch früher haben Epidemien und Pandemien wirre Verschwörungstheorien produziert – wie die Pest im Mittelalter. Und auch Krisensituationen wie die Anschläge des 11. Septembers 2001 brachten eine Vielzahl von Verschwörungstheorien mit sich. Bei Corona kam hinzu: Das Virus war so neu, dass gesicherte Erkenntnisse darüber noch nicht existierten und sich der Stand der Forschung stetig entwickelte. Die Pandemie betraf uns alle und löste große Ängste, auch um die wirtschaftliche Zukunft, aus. Damit bot sie den idealen Nährboden für gefälschte Geschichten auf Facebook, YouTube oder über Messenger, deren Überschrift oft mit „Die Wahrheit über ...“ begannen.
Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wurden hier die absurdesten Verschwörungstheorien verbreitet. Die Feindbilder dabei waren oft Politikerinnen und Politiker und etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn die gehören laut den Verbreitenden der Verschwörungen zur „dunklen globalen Elite“, die eine „Corona-Diktatur“ und eine „neue Weltordnung“ errichten wollten.
Die vermeintlich Kritischen stellen sich gegen die „finstere“ globale Elite
Das Grundprinzip von Verschwörungstheorien ähnelt sich meist: Auf der einen Seite wird die finstere globale Elite heraufbeschworen, die alle manipulieren will. Und auf der anderen Seite gibt es die wenigen angeblich Guten und Kritischen, die das durchblicken und die Wahrheit kennen. Andre Wolf von der Faktencheck-Plattform www.mimikama.at spricht von „Verschwörungslegenden“ und sagt: „Sie bieten einfache Antworten auf komplexe Fragen und damit auch Halt. Sie geben vor, dass ein Plan hinter alldem steckt und man nicht einfach irgendeinem Zufall ausgeliefert ist. Da dieser Plan ein böser ist, errichten Verschwörungslegenden Feindbilder, sodass Angst und Wut kanalisiert werden können.“
So haarsträubend vieles davon klingen mag: Der Einfluss von digitalen Botschaften auf Menschen ist enorm – und hat Folgen für ihr Verhalten in der echten Welt. So kam es in Großbritannien schon zu Brandanschlägen auf Funkmasten, nachdem Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker behauptet hatten, dass das 5G-Handynetz die Verbreitung von Covid-19 begünstigen würde. Auch in Deutschland tragen Menschen die wirren Theorien aus dem Netz auf die Straße, verstoßen gegen Verordnungen oder greifen sogar Polizistinnen und Polizisten an.

So erkennst du Falschmeldungen
Umso wichtiger ist es, Fake News, Panikmache und Propaganda zu erkennen und dagegen vorzugehen. Dazu Experte Wolf: „Typisch für Falschmeldungen und Verschwörungslegenden ist der manipulative Rahmen mithilfe von Schlagbegriffen. Ferner ist ein Blick auf die Herkunft einer Information wichtig: Handelt es sich um eine anonyme Quelle oder um eine seriöse Redaktion?“ In Deutschland gibt es die Pflicht, ein Impressum anzugeben. Fehlt dieses oder ist die Adresse der Absenderin oder des Absenders im Ausland, spricht das nicht für Vertrauenswürdigkeit. Quellen und Zitate lassen sich im Internet gegenchecken. Gibt es mehrere Quellen? Und in welchem Zusammenhang sind die Zitate noch zu finden? In den sozialen Medien sollte man sich das Profil der Absenderin oder des Absenders genauer anschauen, bevor man ein Posting teilt.
Auch das Manipulieren von Fotos ist bei Fake-News-Macherinnen und -Machern weit verbreitet. Oft wird nur ein Bildausschnitt gezeigt, wodurch der ursprüngliche Zusammenhang des Fotos verfälscht wird. Hier kann es helfen, das Foto in der Bildersuche bei Google hochzuladen, um so das Original oder ganz ähnliche Bilder vom gleichen Vorfall zu finden.
Folgende Seiten helfen beim Fake-News-Check:
- Die Website Hoaxmap (www.hoaxmap.org) listet Gerüchte auf, die als Fake News entlarvt worden sind. Falschmeldungen sind nach Bundesländern aufgeführt, man kann auch nach Schlagworten suchen.
- Der Faktenfinder der ARD-Tagesschau (http://faktenfinder.tagesschau.de) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fakten und Hintergründe zu umstrittenen Gerüchten zu liefern. Hier wird etwa die Behauptung, die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten hätten den Muttertag erfunden, genauso erläutert, wie der richtige Umgang mit Statistiken.
- Hinter First Draft News (https://de.firstdraftnews.com/) steht die gemeinnützige Vereinigung First Draft. Hier finden sich in mehreren Sprachen Hinweise zum Umgang mit zweifelhaften News, Bildern und Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden. Der Fokus hier liegt auf internationalen Meldungen.
- Die im Auftrag der EU-Kommission eingerichtete Website Klicksafe (www.klicksafe.de) bietet Beratung und Hintergrundinformationen für Jugendliche, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer zum sicheren Umgang mit den neuen Medien.
- Die österreichische Website Mimikama (www.mimikama.at) ist eine Plattform, die Hinweisen von Userinnen und Usern auf Fake News nachgeht und diese überprüft. Sie hat auch eine Suchfunktion, Hoaxsearch, mit der du gezielt nach Schlagworten suchen kannst. Andre Wolf von Mimikama sagt: „Vor der Corona-Krise hatten wir täglich 80 bis 120 Anfragen und Hinweise. Anfang März ist diese Zahl auf 400 bis 450 angestiegen.“
Corona-Pandemie: Weniger Falschmeldungen, mehr Verschwörungstheorien
Während der Pandemie haben Wolf und seine Kolleginnen und Kollegen bei Mimikama festgestellt, dass die klassischen Falschmeldungen eher zurückgegangen sind. Stattdessen seien immer mehr absurde Verschwörungslegenden aufgetaucht. Wolf: „Diese Legenden wurden durch bestimmte Influencerinnen und Influencer innerhalb der Szene stark befördert. Anfangs war das Xavier Naidoo, mittlerweile ist der Vegan-Koch und Unternehmer Attila Hildmann federführender Influencer in diesem Spektrum geworden. Mit seinen Anspielungen lässt er es auch durchaus auf Gewalt ankommen.“ Auch sei Facebook nicht mehr die bevorzugte Plattform der Fake-News-Verbreiterinnen und Fake-News-Verbreiter. Wolf: „Speziell der Messenger Telegram rückt hier immer mehr in den Blickpunkt.“
Bitte beachten Sie: Sobald Sie sich das Video ansehen, werden Informationen darüber an Youtube/Google übermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Google Datenschutzerklärung.
Ältere Jugendliche sind sensibilisiert für Fake News
Sind Jugendliche, die ja Social Media und Messenger-Dienste intensiv nutzen, besonders anfällig für Fake News und Verschwörungs-Märchen? Andrea Kersting aus der Abteilung Entwicklung & Projekte der Malteser Schulen hat die Erfahrung gemacht: „Ein Großteil der Jungen und Mädchen ist sehr sensibilisiert, wenn es um Hass und Falschmeldungen aus dem Internet geht.“ Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch eine Studie der Medienanstalt Baden-Württemberg zur Internetnutzung von Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren. waren 61 Prozent der Jugendlichen im letzten Monat vor der Befragung mit Fake News und 40 Prozent mit Hassbotschaften im Netz konfrontiert worden. Allerdings betont die Malteser-Expertin Kersting: „Jüngere Kinder haben noch nicht ein so kritisches Verständnis von zuverlässigen Quellen, sie erkennen Fake News nicht sicher und sind ihnen mehr ausgesetzt.“
News Avoidance
Die massive Nachrichtenflut, welche aufgrund diverser nationaler und internationaler Krisen zu einem Großteil aus negativen Schlagzeilen besteht, kann ziemlich belastend sein. Immer mehr Jugendliche versuchen deshalb, dem zu entgehen, indem sie keine oder nur noch sehr selten Nachrichten konsumieren. Genau diese Entwicklung beschreibt der Begriff „News Avoidance“ – englisch für „Nachrichtenvermeidung“.
Die wachsende Rolle von KI
Mit der Einführung von Chat GPT hat das Thema Künstliche Intelligenz deutlich an Fahrt aufgenommen. Laut der Studie der Medienanstalt Baden-Württemberg nutzen 62 Prozent der befragten Jugendlichen KI-Anwendungen – 43 Prozent auch bei der Suche nach Informationen. Die Infos, welche Tools wie Chat GPT ausspucken, sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, denn deren genaue Herkunft ist oftmals nicht eindeutig.
Zudem kursieren im Internet auch immer öfter gefakte Bilder oder Videos von Personen des öffentlichen Lebens. Häufig ist dabei nicht direkt klar, ob diese real sind oder nicht. Ganz im Gegenteil: Bei einigen dieser Deepfakes braucht es mitunter das geschulte Auge einer Expertin oder eines Experten, um diese Frage eindeutig zu beantworten.
Besonders gefährlich wird es jedoch, wenn diese von einer KI generierten Medieninhalte benutzt werden, um den abgebildeten Personen zu schaden. Denn nicht immer werden die Inhalte mit guten Absichten erstellt. Und abgesehen von dem persönlichen Schaden, der für die Einzelperson dabei entsteht, können die Inhalte auch größere Folgen haben. Denn gerade im politischen Zusammenhang, etwa bei Wahlen, kann der Schaden auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. Es wird in Zukunft also noch wichtiger sein, die konsumierten Inhalte kritisch zu hinterfragen und zu prüfen.
Was sind eigentlich Deepfakes?
Deepfakes sind täuschend echte Inhalte, die jedoch mithilfe von KI erstellt wurden. Dabei kann es sich um Bilder, Videos oder Sprachaufnahmen handeln. Die abgebildeten Personen können dabei real existieren oder aber auch vollkommen neu erschaffen sein.
Bitte beachten Sie: Sobald Sie sich das Video ansehen, werden Informationen darüber an Youtube/Google übermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Google Datenschutzerklärung.
Ein selbstkritischer Umgang mit Medien ist wichtig
Andrea Kersting betont: „Wir Erwachsenen sollten für Gespräche offen sein und zur Verfügung stehen. Was sind sichere Quellen? Wie checke ich sie? Und warum ist es gut, mehrere Informationsquellen zu nutzen?“ Junge Menschen würden meist ohnehin mehrere Quellen nutzen, wenn sie sich über ein Thema informieren wollten. Hier seien Kinder mit höherer Schulbildung klar im Vorteil. Kersting: „Je höher der Bildungsstand, desto kritischer setzen sie sich in der Regel mit Informationen auseinander.“
Auch Fake-News-Experte Wolf plädiert für einen selbstkritischen Umgang mit dem eigenen Medienkonsum. Also sich mit den Fragen zu beschäftigen: Was lese ich? Warum lese ich bestimmte Inhalte? Wie transparent und seriös sind meine Quellen? Wichtig sei, so Wolf, dass man sich bewusst mit dem Thema beschäftige und sich darüber im Klaren ist: „Speziell in den Sozialen Medien wird jeder immer wieder mit Behauptungen, Falschmeldungen und Legenden konfrontiert.“