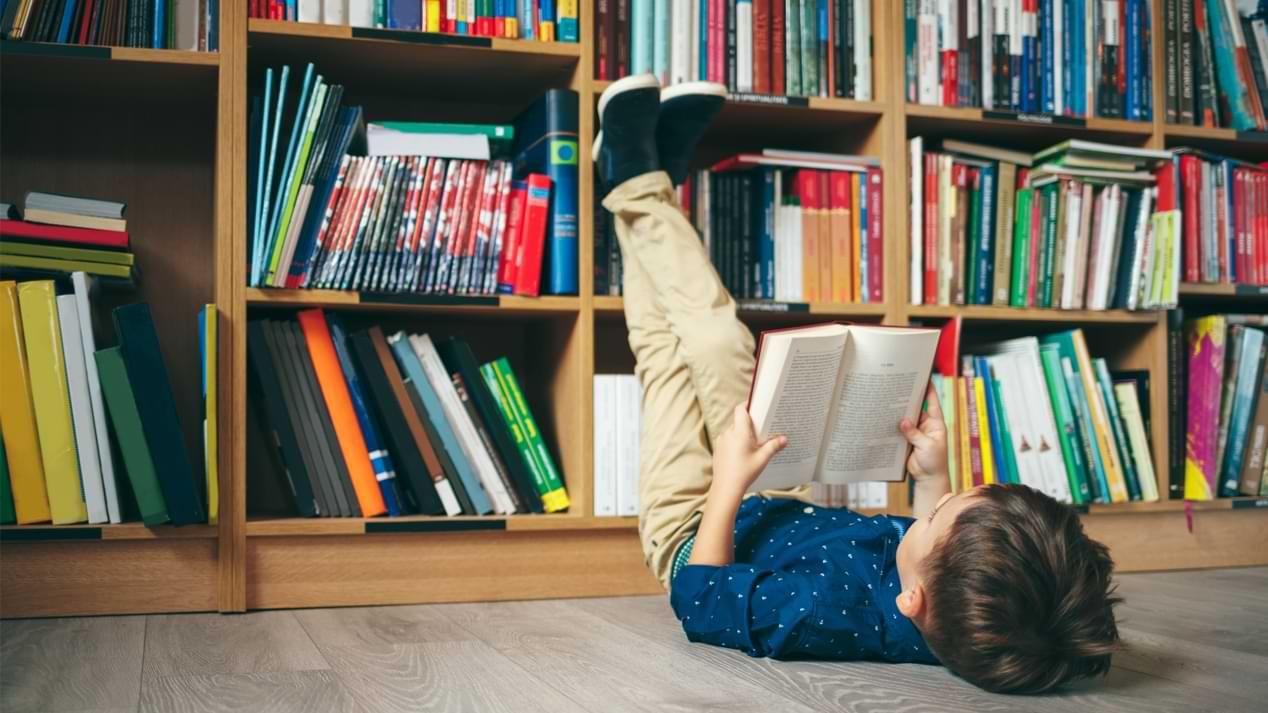Spontanhelfer in Aktion bei Hochwasser, Feuer und Flut
Sie stapeln Sandsäcke, verteilen Hilfsgüter oder betreuen Betroffene: sogenannte Spontanhelferinnen und Spontanhelfer. Ihr Engagement ist in Katastrophensituationen unverzichtbar. Doch wie genau werden spontane Hilfsaktionen koordiniert? Die wichtigsten Infos zum Thema findest du hier.
Darum geht's
- Wenn Sekunden zählen: Spontane Unterstützung im Ernstfall
- Was genau sind Spontanhelferinnen und Spontanhelfer?
- Gibt es verschiedene Arten von Spontanhelferinnen und Spontanhelfern?
- Welche Eigenschaften brauche ich, wenn ich mitmachen möchte?
- Wie organisieren sich die Spontanhelfenden?
- Welche rechtlichen Aspekte sind relevant?
- Wie kann ich mich als Spontanhelfender vorbereiten?
Wenn Sekunden zählen: Spontane Unterstützung im Ernstfall
In den kritischsten Momenten einer Krise sind es nicht immer die hauptamtlichen Profis, die zuerst helfen – es sind oft die Menschen von nebenan. Spontane Helferinnen und Helfer können ein entscheidender Faktor bei der Notfallbewältigung sein. Sie reagieren schnell, unbürokratisch und selbstlos. Wenn Sirenen heulen, Straßen überschwemmt sind oder Brände wüten, sind sie es, die nicht wegschauen, sondern anpacken. Immer wieder sind es diese Bürgerinnen und Bürger mit Zivilcourage, die mit ihrem Einsatz die Minuten zwischen Katastrophe und professioneller Hilfe überbrücken. Und auch danach spielen sie in Krisensituationen oft eine wichtige Rolle.
Was genau sind Spontanhelferinnen und Spontanhelfer?
Spontanhelfende bieten bei Großschadenslagen oder Katastrophen freiwillig und unabhängig von Einsatzorganisationen ihre Hilfe an. Sie entscheiden sich kurzfristig und ohne umfangreiche Vorplanung, bei der Bewältigung von Schadensereignissen mitzuwirken. Sie sind nicht formell in Hilfsorganisationen wie etwa den Maltesern eingebunden und haben keine spezielle Ausbildung im Bevölkerungsschutz. Ihre Hilfe erfolgt freiwillig und ohne finanzielle Vergütung. Bei Naturkatastrophen oder sogenannten Großschadenslagen leisten Spontanhelferinnen und Spontanhelfer einen wichtigen Beitrag – insbesondere in Situationen, die die Kapazitäten der Einsatzkräfte übersteigen. So haben sich beispielsweise immer wieder bei Hochwasser-Katastrophen Menschen spontan bereit erklärt, bei der Bewältigung dieser Lagen ehrenamtlich zu unterstützen. Viele Spontanhelfende unterstützen auch Geflüchtete – etwa aus Syrien oder der Ukraine.
Gibt es verschiedene Arten von Spontanhelferinnen und Spontanhelfern?
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Arten von Spontanhelfenden:
- Integrierte Spontanhelferinnen und -helfer: Diese haben sich beim Verwaltungs- oder Krisenstab registriert und werden zentral oder dezentral auf Einsatzabschnitte verteilt.
- Kooperierende Spontanhelferinnen und -helfer: Sie sind nicht registriert und arbeiten parallel zu den Hilfsorganisationen.
Was sind First Responder?
First Responder sind keine Ersthelfenden, die zufällig am Unfallort sind. Sie sind ausgebildet in Erster Hilfe und organisatorisch an Rettungsdienste angebunden. Nach einem Notruf werden über die Ersthelfer-App Freiwillige geortet, die sich in der Nähe befinden, und über den Einsatz informiert. Ihr Standort wird über das GPS ihres Smartphones ermittelt. Im besten Fall können sie sehr schnell am Einsatzort sein, wenn dies notwendig ist. Die First Responder überbrücken die Zeit, bis die Rettungskräfte übernehmen. Mehr Informationen zu First Respondern und Ersthelfer-Apps gibt es hier.

Welche Eigenschaften brauche ich, wenn ich mitmachen möchte?
Für Helferinnen und Helfer sind sowohl psychische als auch physische Faktoren wichtig, um effektiv und sicher in Krisensituationen helfen zu können.
- Körperliche Fitness und ein stabiler Gesundheitszustand sind die Grundvoraussetzungen, besonders für körperlich anstrengende Tätigkeiten – wie etwa Sandsackschleppen gegen ein Hochwasser.
- Ein angemessener Impfschutz basierend auf den Empfehlungen der Deutschen Impfkommission ist ebenfalls ratsam.
- Dazu sollten Spontanhelfende psychisch stabil und belastbar sein, um mit stressigen Situationen und emotionalen Herausforderungen umgehen zu können.
- Geht es darum, Betroffene zu betreuen oder ihnen Trost zu spenden, sind Einfühlungsvermögen und Empathie gefragt.
- Ganz groß geschrieben wird Teamfähigkeit, also die Bereitschaft, sich in bestehende Strukturen einzuordnen und mit anderen zusammenzuarbeiten.
Wie organisieren sich die Spontanhelfenden?
Sie organisieren sich häufig eigenständig über soziale Netzwerke wie WhatsApp, Facebook oder andere digitale Kommunikationsmöglichkeiten. So können sie sich spontan gegründeten Initiativen anschließen oder eigene Gruppen organisieren. Die Nutzung von digitalen Plattformen ist wegen ihrer Geschwindigkeit und allgemeinen Zugänglichkeit ideal für die Kommunikation und Koordination von spontan Helfenden. Allerdings kann die Organisation über soziale Medien auch zu unkoordiniertem Auftreten führen, wenn viele Helferinnen und Helfer gleichzeitig an einem Ort eintreffen. So kam es bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 wegen der großen Zahl an Spontanhelfenden zeitweise zu zusätzlichen Verkehrsproblemen.
Welche rechtlichen Aspekte sind relevant?
Menschen, die bei Katastrophen und Schadenslagen freiwillig helfen, unterliegen in Deutschland bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen. Damit soll sichergestellt werden, dass sie effektiv und sicher in Katastrophenhilfe eingebunden werden können, während gleichzeitig ihr Schutz gewährleistet ist.
- So sind Spontanhelfende über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Diese Versicherung deckt sowohl Körperschäden, psychische Schäden als auch Sachschäden, Sachverluste und Aufwendungen ab.
- Die Haftung für fahrlässig verursachte Schäden ist beschränkt, und bei Integration in die Einsatzstrukturen greift die Amtshaftung. Du musst nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit selbst haften.
- Als integrierte Spontanhelferin oder Spontanhelfer unterstehst du der technischen Einsatzleitung vor Ort. Das heißt: Führungskräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen sind weisungsbefugt. Du hast die Freiheit, den Dienst jederzeit zu beenden, musst jedoch den Anweisungen folgen, solange du im Einsatz bist.
Wie kann ich mich als Spontanhelfender vorbereiten?
Um dich als Spontanhelfender optimal vorzubereiten, solltest du dich umfassend informieren und vernetzen.
- Nutze offizielle Kanäle, um aktuelle Informationen zu sammeln, und baue Netzwerke über soziale Medien auf.
- Schätze deine eigenen Fähigkeiten realistisch ein und plane, diese gezielt einzusetzen.
- Stelle sicher, dass du geeignete Ausrüstung bereithältst.
- Mach dich mit Sicherheitsvorkehrungen vertraut.
- Während des Einsatzes ist effektive Kommunikation entscheidend. Bleibe in Kontakt mit anderen Helferinnen und Helfern, nutze Anlaufstellen und fördere Teamarbeit, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Sei dir deiner Grenzen bewusst und respektiere die der anderen.
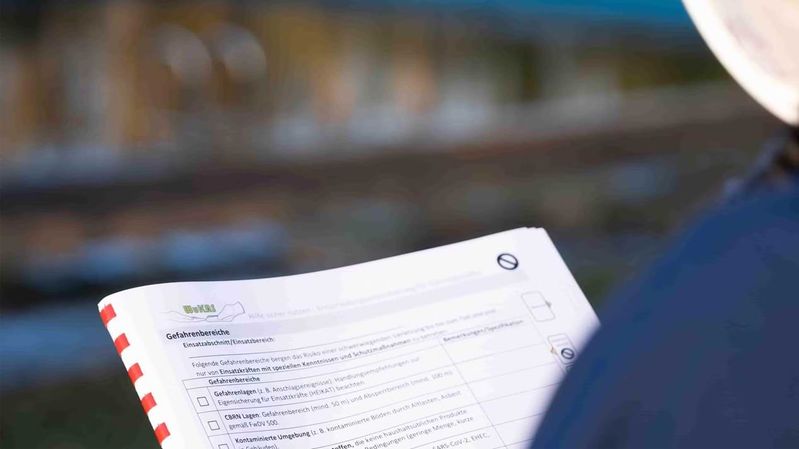
Spontanhelfende sicher einsetzen
Um einen effektiven Einsatz von Spontanhelferinnen und Spontanhelfern zu ermöglichen, ist es für Behörden und Hilfsorganisationen von Bedeutung, diese zu koordinieren und ihre Fähigkeiten zu ermitteln. Aus diesem Grund starteten die Malteser unter anderem ein Projekt, das vom Bundesbildungsministerium gefördert wurde: „WuKAS – Wissens- und Kompetenzvermittlung bei Spontanhelfern im Arbeits- und Gesundheitsschutz“. Das Ziel bestand darin, einen Ansatz zu entwickeln, der Behörden und Organisationen dabei hilft, Spontanhelfende sicher einzusetzen. Hier standen sowohl rechtliche Fragen als auch Sicherheitsaspekte sowie die Qualifikation von Spontanhelfenden im Fokus. Ausführliche Informationen zu dem Projekt gibt es hier.